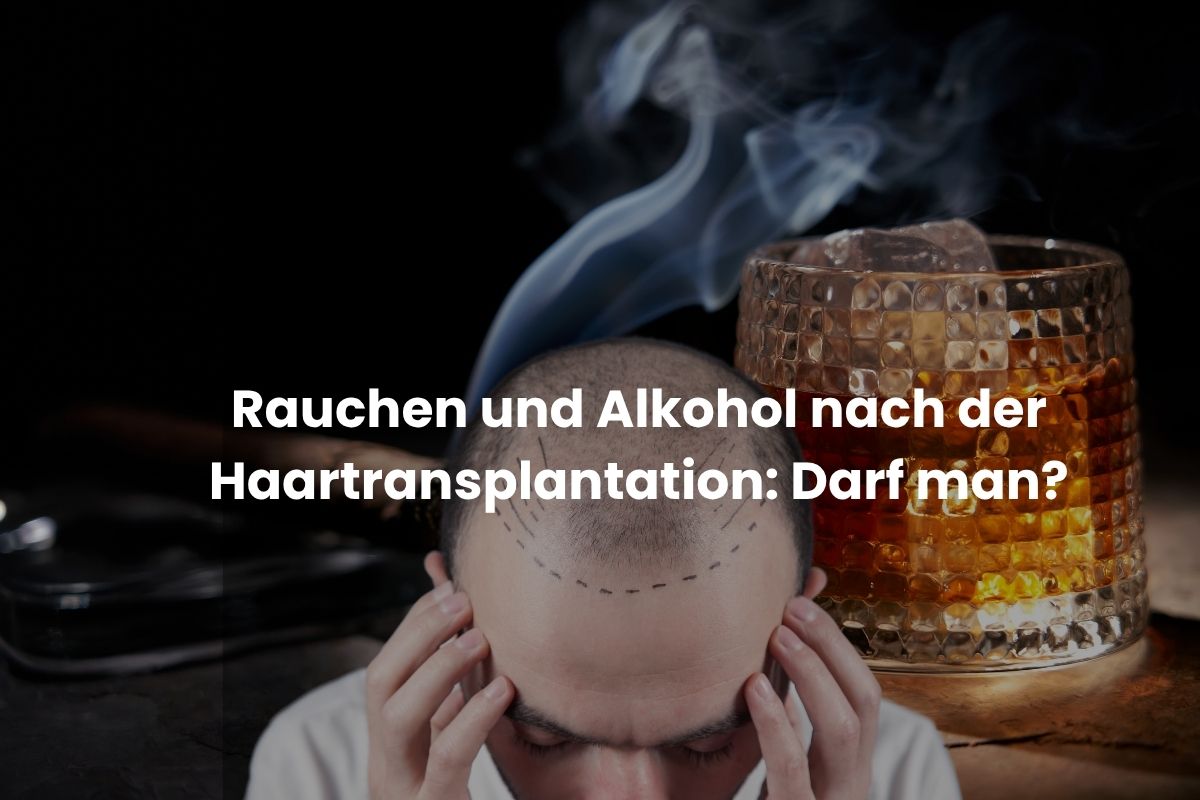Trichotillomanie ist eine Zwangsstörung, bei der sich Betroffene wiederholt die eigenen Haare ausreißen – meist unbewusst und oft bis zur sichtbaren Schädigung der Kopfhaut, Augenbrauen oder Wimpern. Der Drang entsteht meist in stressigen Situationen oder aus innerer Unruhe heraus. Doch was genau steckt hinter dieser rätselhaften Störung?
Ob im Büro unter Druck, beim Lernen in der Nacht oder aus purer Anspannung – die Auslöser sind vielfältig. Was mit einem harmlosen Zupfen beginnt, kann zu kahlen Stellen und tiefem Leidensdruck führen. Besonders tragisch: Viele Menschen schämen sich so sehr, dass sie ihr Verhalten jahrelang verheimlichen.
Studien zufolge leiden rund 1 bis 2 von 50 Personen an Trichotillomanie, wobei etwa 80–90 % der diagnostizierten Erwachsenen Frauen sind. Trotz dieser Zahlen bleibt die Erkrankung oft unerkannt – auch, weil viele selbst nicht wissen, dass ihr Verhalten einen Namen hat und behandelbar ist.
Wie lässt sich Trichotillomanie definieren?
Wusstest du, dass der Begriff „Trichotillomanie“ schon über 100 Jahre alt ist? 1889 wurde er vom französischen Dermatologen François Henri Hallopeau geprägt – aus den Wörtern für Haar, Ziehen und Zwang. Dahinter steckt eine Störung, die viele kennen, aber kaum jemand beim Namen nennt.
Wer darunter leidet, reißt sich oft ungewollt die Haare aus – am Kopf, an den Augenbrauen oder Wimpern. Häufig geschieht das in stressigen Momenten oder völlig nebenbei, ohne es richtig zu merken. Es fühlt sich vielleicht kurz erleichternd an, doch das schlechte Gefühl danach wiegt schwer.
Trichotillomanie betrifft mehr Menschen, als man denkt. Und nicht immer sieht man es auf den ersten Blick. Manche verstecken die kahlen Stellen, andere entwickeln ausgeklügelte Gewohnheiten, um das Verhalten zu tarnen. Was wirklich hilft? Einfühlsame Gespräche, professionelle Hilfe und der Mut, sich mitzuteilen.
Welche Faktoren führen zu dieser Störung?
Warum Menschen sich bei Trichotillomanie die Haare ausreißen, lässt sich nicht auf einen einzigen Auslöser zurückführen. Die Gründe sind individuell – doch Forschungsergebnisse zeigen wiederkehrende Muster. Viele Betroffene berichten, dass sie in Momenten von Stress, innerer Leere, Langeweile oder Angst nicht anders können, als zu dieser Handlung zu greifen.
Für manche ist das Haarreißen ein Moment der Erleichterung, für andere ein fast genussvolles Ritual. Es bleibt oft nicht beim Ausreißen – manche streichen die Haare über die Lippen oder kauen daran. In Einzelfällen kommt es sogar zum Verschlucken, was medizinische Komplikationen nach sich ziehen kann. Ein Verhalten, das selten offen besprochen wird, aber tief greift.
Auch genetische Veranlagung spielt eine Rolle: Wer Familienmitglieder mit ähnlichem Verhalten hat, scheint häufiger betroffen zu sein. Außerdem diskutieren Fachleute ein Ungleichgewicht von Botenstoffen wie Dopamin und Serotonin als möglichen biologischen Faktor. Dazu kommen psychische Belastungen wie Zwangsstörungen, Angst oder Depressionen, die TTM begünstigen können.
Welche psychischen Hintergründe spielen bei Trichotillomanie eine Rolle?
Wenn Menschen sich wiederholt die Haare ausreißen, steckt dahinter nicht bloß ein Tick – oft ist es eine Reaktion auf seelische Überforderung. Trichotillomanie ist dabei nicht selten ein Ventil, um mit innerem Druck umzugehen. Vier psychische Faktoren spielen häufig eine Rolle:
Zwangsstörung (OCD)
Der Drang, Dinge immer wieder zu tun, ist typisch für Zwangsstörungen. Beim Haareziehen erleben Betroffene kurzzeitig Erleichterung – ähnlich wie beim Händewaschen oder Kontrollieren. Es geht weniger um das Haar selbst, sondern um das Gefühl, etwas loszuwerden.
ADHS
Ständig in Bewegung, ständig unter Strom – so fühlen sich viele mit ADHS. Wenn der Kopf zu voll ist, greifen manche reflexartig zu sich selbst. Das Ziehen an den Haaren kann dann unbemerkt zur Angewohnheit werden, die ihnen hilft, sich zu spüren.
Angststörungen
Angst erzeugt oft starken inneren Druck. Das Ausreißen der Haare kann diesen Druck für einen Moment lindern – auch wenn es langfristig keine Lösung ist. Für viele ist es ein instinktiver Weg, mit emotionaler Überforderung klarzukommen.
Autismus
Menschen im Autismus-Spektrum haben oft ein feines Gespür für Reize. Wiederholte Bewegungen wie das Zupfen oder Reißen an den Haaren geben ihnen ein Gefühl von Kontrolle oder Beruhigung. Besonders in ungewohnten oder lauten Umgebungen tritt dieses Verhalten vermehrt auf.
Wie äußern sich die Symptome der Trichotillomanie im Alltag?
Viele Menschen mit Trichotillomanie bemerken erst spät, welche körperlichen Folgen das ständige Ausreißen der Haare hat. Was zunächst wie ein harmloses Zupfen erscheint, hinterlässt mit der Zeit sichtbare Lücken im Haar – und nicht selten bleiben diese dauerhaft bestehen.
Die betroffenen Hautstellen reagieren empfindlich: Sie röten sich, jucken oder bilden kleine Wunden. Manche erleben sogar Narben oder spüren ein Brennen auf der Kopfhaut. Diese Symptome führen oft dazu, dass sich die Betroffenen noch mehr schämen und zurückziehen.
Wenn die Kopfhaut über längere Zeit geschädigt wird, kann es auch zu Entzündungen kommen. Infektionen und gereizte Haarwurzeln erschweren das Nachwachsen zusätzlich. Damit verstärkt sich das Problem – nicht nur äußerlich, sondern auch psychisch.
Wie verändert Trichotillomanie den Alltag der Betroffenen?
Was man auf den ersten Blick sieht – kahle Stellen, fehlende Wimpern oder Augenbrauen – ist nur die Spitze des Eisbergs. Wer unter Trichotillomanie leidet, erlebt oft auch seelisch eine Achterbahnfahrt. Manche essen sogar die ausgerissenen Haare, ohne genau zu wissen, warum.
Die körperlichen Folgen reichen von gereizter, geröteter Haut bis hin zu Narben, die dauerhaft bleiben können. Das Ausreißen wird für viele zur Gewohnheit, besonders in Stressmomenten. Doch das, was kurz beruhigt, hinterlässt langfristige Spuren – auch auf der Seele.
Das Selbstvertrauen schwindet, der Blick in den Spiegel wird schwer. Viele Betroffene ziehen sich zurück, meiden soziale Kontakte oder öffentliche Orte. Schuldgefühle und innere Anspannung münden nicht selten in Angstzuständen oder depressiven Phasen – ein Kreislauf, der allein kaum zu durchbrechen ist.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Trichotillomanie?
Für viele Menschen mit Trichotillomanie fühlt sich der Alltag wie ein ständiger innerer Kampf an. Doch dieser Kampf lässt sich mit der richtigen Hilfe gewinnen. Es gibt verschiedene Wege, mit dem Drang besser umzugehen – man muss sie nur Schritt für Schritt entdecken.
Verhaltenstherapie
Sie ist besonders effektiv. Gemeinsam mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten werden Gedankenmuster hinterfragt und neue Gewohnheiten aufgebaut, um langfristig mehr Kontrolle zu gewinnen.
Gewohnheitsumkehr-Training
Wenn der Drang aufkommt, üben Betroffene eine Gegenbewegung – zum Beispiel das Festhalten eines Steins oder bewusstes Atmen. Es geht darum, das alte Muster zu unterbrechen.
Medikamente
Manchmal kann ein Antidepressivum helfen, besonders wenn Ängste oder depressive Phasen das Verhalten verstärken. Wichtig: Medikamente sind nur ein Teil des Ganzen.
Achtsamkeit & Hypnotherapie
Diese Methoden helfen, in sich hineinzuhorchen und besser mit innerem Druck umzugehen. Viele empfinden sie als hilfreiche Ergänzung zur Gesprächstherapie.
Selbsthilfe & Alltagstricks
Ob durch Austausch mit anderen, das Vermeiden von Spiegeln oder kleine Rituale – auch einfache Mittel im Alltag können den Heilungsprozess unterstützen.
Wie können Menschen mit Trichotillomanie sich selbst helfen?
Manche Betroffene entdecken mit der Zeit Wege, sich selbst zu helfen – ganz ohne professionelle Anleitung. Oft reicht schon eine kleine Handlung, um den Drang zu unterbrechen: die Hände fest zusammenpressen, eine Knetkugel nutzen oder bewusst tief durchatmen.
Ein Tagebuch über die eigenen Impulse kann Wunder wirken. Wer regelmäßig aufschreibt, wann und warum der Drang auftritt, lernt viel über sich selbst. Entspannungsübungen wie Progressive Muskelentspannung oder Autogenes Training helfen zusätzlich, Stress im Vorfeld abzubauen – bevor er sich körperlich zeigt.
Wenn allerdings noch andere psychische Belastungen wie Ängste, Zwänge oder Depressionen dazukommen, ist es ratsam, sich Hilfe zu holen. Denn Trichotillomanie kann in solchen Fällen ein Teil eines größeren Problems sein – und hier hilft oft nur eine gut begleitete Psychotherapie.
Was können Eltern tun, wenn ihr Kind an Trichotillomanie leidet?
Kinder mit Trichotillomanie benötigen Verständnis und gezielte Unterstützung. Das Verhalten ist meist Ausdruck innerer Anspannung und kann durch einen strukturierten Behandlungsansatz gut beeinflusst werden. Hier sind bewährte Methoden im Überblick:
1. Verhaltenstherapie:
Ziel ist es, das Kind für Auslöser zu sensibilisieren. Mit Techniken wie dem Habit-Reversal-Training wird eine alternative Handlung aufgebaut, die dem Haarreißen entgegenwirkt – zum Beispiel das Festhalten eines Gegenstands oder bewusste Handpositionen.
2. Hypnotherapie:
In entspannter Atmosphäre können Kinder lernen, mit Bildern und positiven Suggestionen ihre innere Balance zu stärken. Hypnose wirkt besonders gut, wenn Vertrauen zur Therapeutin besteht.
3. Homöopathie & Medikamente:
Stark verdünnte Mittel können bei leichter Ausprägung unterstützend wirken. In schwereren Fällen kann der Einsatz von SSRIs oder anderen Medikamenten in Erwägung gezogen werden – immer unter ärztlicher Aufsicht.
4. Hausmittel:
Zappelspielzeuge, Stressbälle oder Knetmasse helfen, den Händen eine andere Aufgabe zu geben. Diese kleinen Helfer sind besonders im Schulalltag oder unterwegs nützlich.
Welche zwei Hauptformen der Trichotillomanie gibt es?
Nicht jeder Mensch, der sich Haare ausreißt, tut dies aus denselben Gründen oder auf die gleiche Weise. Bei Trichotillomanie unterscheiden Fachleute zwei Hauptformen: die automatische und die fokussierte Variante. Diese Unterscheidung ist entscheidend, um besser verstehen zu können, wie das Verhalten entsteht – und wie man es behandeln kann.
1. Automatische Trichotillomanie
Bei dieser Form reißen sich die Betroffenen die Haare meist unbewusst aus. Es passiert oft ganz nebenbei – etwa beim Fernsehen, Nachdenken oder Lernen. Viele merken erst später, dass sie es getan haben. Die Handlung wirkt wie ein Reflex, nicht wie eine bewusste Entscheidung.
Es gibt drei Subtypen:
- Hoch automatisch – niedrig fokussiert
- Hoch automatisch – hoch fokussiert
- Niedrig automatisch – niedrig fokussiert
Diese Form geht häufig mit emotionalem Stress oder innerer Anspannung einher, der unbewusst durch die Handlung abgebaut wird.
2. Fokussierte Trichotillomanie
Im Gegensatz dazu erfolgt das Haarreißen bei der fokussierten Variante bewusst. Die Betroffenen spüren einen inneren Drang und geben ihm gezielt nach – oft, um Stress oder unangenehme Gefühle zu regulieren.
Auch hier werden drei Typen unterschieden:
- Hoch fokussiert – hoch automatisch
- Hoch fokussiert – niedrig automatisch
- Niedrig fokussiert – niedrig fokussiert
Das Verhalten ist meist ritualisiert und stark mit bestimmten Gedanken oder Emotionen verknüpft, was das Aufhören besonders schwierig macht.
Wie häufig tritt Trichotillomanie in der Bevölkerung auf?
Schon im 19. Jahrhundert begannen Fachleute damit, sich intensiv mit dem Phänomen des zwanghaften Haarziehens zu beschäftigen. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche medizinische Studien durchgeführt, die zeigen, dass die Störung weiter verbreitet ist, als lange angenommen wurde.
Die Lebenszeitprävalenz liegt bei etwa 0,6 %. Wenn man jedoch auch Menschen berücksichtigt, die nicht alle Kriterien für eine eindeutige Diagnose erfüllen, steigen die Zahlen deutlich an: Bei Frauen liegt der Wert dann bei 3,4 %, bei Männern bei rund 1,5 %. Das verdeutlicht, wie viele betroffen sind – ohne es offen zu zeigen.
Viele von ihnen behalten ihr Verhalten für sich. Aus Scham oder Unsicherheit sprechen sie mit niemandem darüber und scheuen den Gang zur Therapie. Dabei wäre genau das oft der erste Schritt zur Besserung.
Können ausgezupfte Haare bei Trichotillomanie wieder nachwachsen?
Ja, in vielen Fällen wächst das Haar nach einer Phase der Trichotillomanie wieder nach. Wie schnell und in welchem Umfang das passiert, ist individuell verschieden. Mit der richtigen Behandlung und einer gesunden Pflegeroutine stehen die Chancen aber gut, dass sich das Haarbild wieder erholt.
Ob das Haar dauerhaft geschädigt ist, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab. Wer über längere Zeit intensiv Haare ausreißt, riskiert, dass sich kahle Stellen bilden, die sich nicht mehr regenerieren. Auch Narben auf der Kopfhaut können das Nachwachsen verhindern.
Kritisch wird es vor allem dann, wenn keine rechtzeitige Hilfe gesucht wird. Ohne medizinische Unterstützung, therapeutische Begleitung oder gezielte Pflege steigt das Risiko für bleibenden Haarverlust deutlich.
Was hilft Betroffenen mit Trichotillomanie, um das Haarwachstum zu fördern?
Auch wenn Trichotillomanie eine belastende und langwierige Störung ist, gibt es Möglichkeiten, das Verhalten zu durchbrechen und das Haarwachstum zu unterstützen. Neben professioneller Hilfe können auch gezielte Alltagsstrategien dabei helfen, den Drang zu kontrollieren und der Kopfhaut etwas Gutes zu tun. Hier sind hilfreiche Tipps – mit einfacher Anleitung zur Anwendung:
1. Trigger finden
Achte bewusst auf Situationen, in denen du zum Haareziehen neigst. Schreibe auf, was du gerade tust, denkst oder fühlst. So erkennst du wiederkehrende Auslöser schneller.
2. Stress behandeln
Setze auf Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder Meditation, um innere Anspannung abzubauen.
3. Kopfhautpflege
Verwende milde, beruhigende Shampoos und massiere die Kopfhaut regelmäßig sanft, um die Durchblutung zu fördern und Reizungen vorzubeugen.
4. Haarpflege
Pflege deine Haare mit feuchtigkeitsspendenden Kuren oder Ölen. Vermeide straffe Frisuren, heißes Styling und aggressive Produkte.
5. Haarschmuck verwenden
Nutze Haarbänder, Stirnbänder oder Mützen, um unbewussten Griffen zur Kopfhaut vorzubeugen und das Reizen der betroffenen Stellen zu erschweren.
6. Spielzeug finden
Halte kleine Gegenstände wie Stressbälle, Knetmasse oder Fidget-Toys bereit, um deine Hände in kritischen Momenten sinnvoll zu beschäftigen.
7. Gesundes Essen
Setze auf eine nährstoffreiche Ernährung mit Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren, Zink und Eisen – das stärkt die Haarstruktur von innen heraus.
8. Vitamine verwenden
Sprich mit einer Fachperson über Nahrungsergänzungsmittel wie Biotin, Vitamin D oder Zink, die das Haarwachstum positiv beeinflussen können.
9. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen
Suche frühzeitig Rat bei Psychotherapeuten, Dermatologen oder spezialisierten Fachkliniken – besonders, wenn du alleine nicht weiterkommst.
10. Verhaltenstherapien
Lerne Techniken wie das Habit-Reversal-Training, um automatisierte Abläufe zu erkennen und durch gezielte Ersatzhandlungen zu ersetzen.
11. Kognitive Therapie
Arbeite gemeinsam mit Therapeut:innen an den Gedankenmustern, die den Haarzieh-Impuls verstärken. Ziel ist es, langfristig neue Denkroutinen zu etablieren.
Wie erfolgreich ist eine Haartransplantation bei Trichotillomanie-Patienten?
Ob eine Haartransplantation nach Trichotillomanie infrage kommt, hängt von verschiedenen Kriterien ab. Für ein stabiles Ergebnis ist es wichtig, dass die zugrunde liegende Störung nicht mehr aktiv ist. Um das zu überprüfen, sollten folgende Punkte mit „Nein“ beantwortet werden:
- Besteht aktuell noch der Impuls zum Haareziehen?
- Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten Haare ausgerissen?
- Gibt es Symptome wie Kopfhautjucken oder -brennen?
- Vergrößert sich der betroffene Bereich weiter?
- Leiden Sie an gesundheitlichen Vorerkrankungen?
- Sind Sie noch nicht volljährig?
Wenn keine dieser Punkte zutrifft, ist eine Haartransplantation eine realistische und langfristige Lösung.
Die 5 häufigsten Fragen zu Trichotillomanie
1. Kann Trichotillomanie wirklich vererbt werden?
Ja, das ist möglich. Viele Menschen berichten, dass auch ihre Eltern oder Geschwister betroffen sind. Wissenschaftler vermuten, dass es eine genetische Anfälligkeit geben könnte.
2. Welche Haare sollte man besonders schützen?
Eigentlich alle – vor allem aber die, die man unbewusst oder zwanghaft zupft. Meistens sind das die Kopfhaare, Wimpern oder Brauen. Besser ist es, Alternativen wie Stressbälle zu nutzen.
3. Wie kann ich helfen, wenn jemand in meiner Familie betroffen ist?
Verständnis zeigen, Gespräche anbieten, zusammen Lösungen suchen. Manchmal genügt schon Ihre Geduld und Präsenz, um einen Unterschied zu machen. Wichtig ist: nicht bewerten, sondern begleiten.
4. Was kann passieren, wenn nichts unternommen wird?
Mit der Zeit können kahle Stellen dauerhaft bleiben. Auch die Seele leidet – Gefühle wie Scham oder Selbstzweifel schleichen sich ein. Deshalb ist Unterstützung so wichtig.
5. Ist das wirklich eine „ernsthafte“ Krankheit?
Ja, absolut. Trichotillomanie ist mehr als eine schlechte Angewohnheit. Es ist eine psychische Störung, die Menschen belastet – körperlich und emotional. Und sie verdient ernst genommen zu werden.