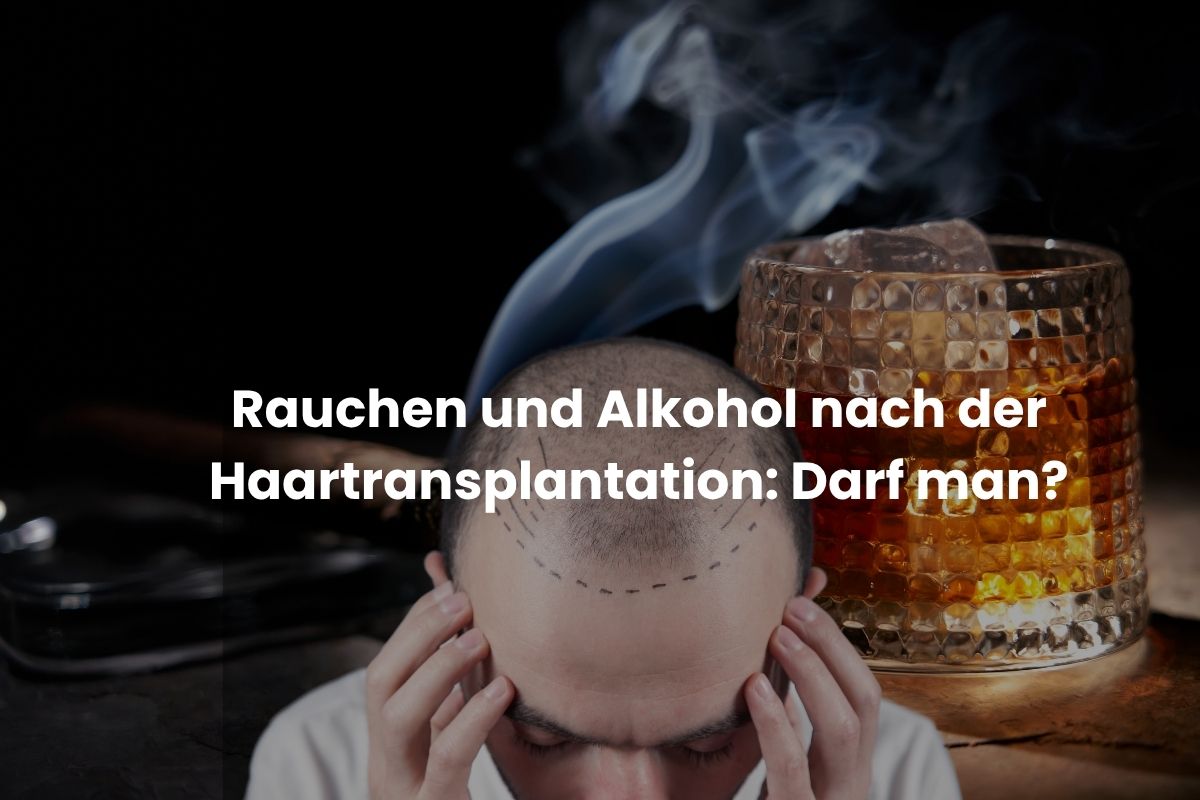Wenn plötzlich runde oder unregelmäßige kahle Stellen auf der Kopfhaut, in den Augenbrauen oder im Bartbereich erscheinen, ist der Schreck oft groß. Nicht selten steckt eine Autoimmunreaktion dahinter – etwa die Alopecia Areata, bei der das Immunsystem fälschlicherweise die eigenen Haarwurzeln angreift. Doch auch hormonelle Veränderungen, Nährstoffmängel, Stress oder Hauterkrankungen können eine Rolle spielen. Solche sichtbaren Lücken sind nicht nur ein kosmetisches Problem – sie können auch psychisch stark belasten.
Gerade dann stellt sich für viele Betroffene die Frage: Abwarten oder aktiv werden? Sollte man sofort eine ärztliche Abklärung vornehmen lassen oder zunächst auf eine spontane Besserung hoffen? Die gute Nachricht ist: In vielen Fällen gibt es wirkungsvolle Behandlungsansätze und die kahlen Stellen sind nicht dauerhaft. Wichtig ist, frühzeitig die Ursache zu erkennen und gezielt zu handeln.
Im folgenden Beitrag beleuchten wir die häufigsten Auslöser kahler Stellen, erklären, welche Therapien sinnvoll sein können und geben praktische Tipps für den Alltag und die Haarpflege. Denn wer informiert ist, kann selbstbewusster mit der Situation umgehen und gezielte Schritte zur Verbesserung einleiten.
Was sind die Symptome kahler Stellen bei Alopecia Areata?
Der kreisrunde Haarausfall, medizinisch als Alopecia Areata bezeichnet, ist durch typische, gut abgegrenzte haarlose Stellen gekennzeichnet. Zu Beginn der Erkrankung erscheinen meist runde oder ovale kahle Areale auf der Kopfhaut, die weder gerötet noch schuppig sind und auch keinen Juckreiz verursachen. An den Rändern dieser Stellen finden sich manchmal kurze, abgebrochene Haare – sogenannte Komma- oder Ausrufezeichenhaare, ein wichtiges diagnostisches Merkmal.
In manchen Fällen fallen nur pigmentierte Haare aus, während graue oder weiße Haare bestehen bleiben, was zu dem Eindruck führen kann, dass die betroffene Person plötzlich ergraut ist. Der Haarverlust tritt häufig in Schüben auf und kann sich im Verlauf ausweiten. Neben der Kopfhaut können auch Augenbrauen, Bart, Wimpern und andere Körperstellen betroffen sein. In schweren Fällen entwickelt sich daraus eine Alopecia Totalis (vollständiger Haarverlust auf dem Kopf) oder sogar eine Alopecia Universalis (Haarverlust am gesamten Körper).
Statistisch gesehen betrifft Alopecia Areata etwa 1 bis 2 % der Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens. In Deutschland leiden schätzungsweise etwa 1 Million Menschen an dieser Form des Haarausfalls. Die Erkrankung kann in jedem Alter auftreten, wobei der Erstausbruch häufig vor dem 30. Lebensjahr liegt. Männer und Frauen sind in etwa gleich häufig betroffen.
Rund 20–25 % der Betroffenen zeigen zusätzlich Veränderungen an den Finger- und Fußnägeln. Diese äußern sich durch kleine Grübchen, Längsrillen, weiße Flecken oder eine brüchige Oberfläche. Solche Nagelveränderungen treten häufig bei schwereren Verlaufsformen auf und können Jahre nach dem ersten Auftreten des Haarausfalls sichtbar werden.
Zu welchen Zeitpunkten und wie häufig tritt die Kahlheit auf?
Etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an Alopecia areata und entwickeln dabei charakteristische kahle Stellen, meist am Kopf. In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Erkrankung im Kindes- oder jungen Erwachsenenalter; über 80 Prozent der Betroffenen sind jünger als 40 Jahre. Auch eine familiäre Häufung kann beobachtet werden, was auf eine genetische Veranlagung hinweist.
Männer und Frauen sind in etwa gleich häufig betroffen. Allerdings zeigen Studien, dass Frauen unter dem veränderten Haarbild psychisch oft stärker leiden. Auch im Kindesalter ist die Geschlechterverteilung weitgehend ausgeglichen.
Obwohl sich Alopecia areata in vielen Fällen spontan zurückbildet, ist die Rezidivrate sehr hoch. Wer einmal an kreisrundem Haarausfall erkrankt ist, hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, erneut davon betroffen zu sein. Je länger der Verlauf anhält, desto wahrscheinlicher wird ein chronisches Erscheinungsbild.
Warum entstehen kahle Stellen auf dem Kopf?

In den meisten Fällen liegt eine Alopecia Areata vor, wenn plötzlich kahle Stellen an Kopfhaut, Augenbrauen oder Bart sichtbar werden. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunreaktion, bei der das Immunsystem die Haarfollikel fälschlicherweise angreift. Diese Entzündung führt dazu, dass die Haarwurzeln ihre Funktion einstellen und das Haarwachstum stoppt – mit nachfolgendem Haarausfall.
Eine Übersicht über diese Immunreaktion bietet ein Artikel der National Library of Medicine (NIH).
Ein weiteres Indiz für den Autoimmun-Ursprung ist, dass viele Betroffene gleichzeitig an anderen Autoimmunerkrankungen leiden. Dazu zählen etwa Hashimoto-Thyreoiditis, Vitiligo oder Neurodermitis. Laut einer Studie, veröffentlicht in Nature Reviews Disease Primers, besteht eine erhöhte Prävalenz von Autoimmunerkrankungen bei Patienten mit Alopecia Areata.
Zudem zeigen genetische Analysen eine familiäre Häufung – es wird angenommen, dass bestimmte Genvarianten das Erkrankungsrisiko erhöhen. Mehr dazu findet sich in einer genomweiten Assoziationsstudie im Journal of Investigative Dermatology.
Auch psychologische Faktoren wie akuter Stress oder Traumata können eine Rolle spielen. Mehrere Studien, darunter eine im British Journal of Dermatology, zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen psychischem Stress und dem Ausbruch oder der Verschlechterung von Alopecia Areata.
Schließlich wurde bei Patienten mit Down-Syndrom eine signifikant erhöhte Rate an kreisrundem Haarausfall festgestellt. In neuerer Zeit wurde außerdem beobachtet, dass manche Personen nach einer COVID-19-Erkrankung Symptome von Alopecia Areata entwickeln – eine mögliche immunologische Spätfolge, wie in diesem Übersichtsartikel dargestellt wird.
Ist ein erneutes Haarwachstum möglich?

Der Verlauf der Alopecia areata ist individuell sehr unterschiedlich, folgt aber häufig einem typischen Muster: Anfangs entstehen kleine, runde, kahle Stellen – meist auf der Kopfhaut –, die im Laufe der Zeit größer werden und miteinander verschmelzen können. Laut Studien erleben bis zu 70 Prozent der Betroffenen innerhalb eines Jahres eine spontane Besserung, bei der das Haarwachstum ganz ohne medizinische Intervention wieder einsetzt.
In vielen Fällen wachsen die ersten neuen Haare zunächst weiß oder farblos nach. Das liegt daran, dass das fehlgeleitete Immunsystem insbesondere die Melanozyten – also die Zellen, die für die Pigmentierung zuständig sind – angreift. Besonders bei milden Verläufen sind Spontanheilungen relativ häufig, bieten jedoch keine Garantie für eine dauerhafte Stabilität. Rückfälle (Rezidive) kommen auch nach Jahren noch häufig vor.
Gerade in schwereren Fällen oder bei chronischen Verläufen ist es sinnvoll, auf spezialisierte Behandlungsformen zurückzugreifen. Eine bewährte Methode ist hier die FUE-Haartransplantation, bei der einzelne Haarfollikel entnommen und in die betroffenen Bereiche verpflanzt werden. Die Klinik LeicesterHaar bietet auf diesem Gebiet besonders hohe medizinische Standards und verfügt über ein erfahrenes Team von Spezialisten, das sich auf Haartransplantationen bei Autoimmun-Haarausfall spezialisiert hat. Dank ihrer modernen Technik und individuellen Betreuung zählt LeicesterHaar zu den führenden Anbietern auf diesem sensiblen Gebiet.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei Alopecia areata?

Frühe Diagnose ist entscheidend
Wer bei sich selbst Symptome einer Alopecia areata bemerkt – zum Beispiel plötzlich auftretende, runde kahle Stellen – sollte so früh wie möglich einen Dermatologen oder Haarspezialisten aufsuchen. Eine rechtzeitige Diagnose erhöht die Erfolgschancen der Behandlung deutlich.
Medikamentöse Behandlungsoptionen
Kortisonpräparate gehören zu den am häufigsten eingesetzten Therapien. Sie können lokal als Creme oder Lösung angewendet, bei kleinen Arealen direkt in die Kopfhaut injiziert oder systemisch in Tablettenform verabreicht werden. Die Wirkung hält meist nur während der Anwendung an, und Nebenwirkungen sind möglich.
Topische Immuntherapie
Die Behandlung mit Diphenylcyclopropenon (DCP) zählt zu den sogenannten topischen Immuntherapien. Dabei wird gezielt eine allergische Reaktion auf der Kopfhaut ausgelöst, um fehlgeleitete Immunzellen von den Haarfollikeln abzulenken. Diese Methode kommt vor allem bei größeren kahlen Flächen zum Einsatz und wird nur in spezialisierten Zentren angeboten.
Hautreizende Substanzen
Substanzen wie Anthralin (Cignolin) oder Dithranol verursachen eine leichte Entzündung an der betroffenen Stelle und sollen so das Haarwachstum stimulieren. Die Wirksamkeit ist individuell unterschiedlich – zeigt sich nach drei Monaten keine Verbesserung, wird die Behandlung meist beendet.
PUVA-Lichttherapie
Bei der PUVA-Therapie wird der Wirkstoff Psoralen auf die Haut aufgetragen und anschließend mit UV-A-Licht bestrahlt. Diese Therapie kann die Autoimmunreaktion, die die Haarfollikel angreift, reduzieren und wird häufig bei chronischen Verläufen eingesetzt.
Regenerative Therapieansätze
Zu den modernsten Behandlungsmöglichkeiten zählt die PRP-Therapie (Plättchenreiches Plasma). Dabei wird dem Patienten Blut entnommen, speziell aufbereitet und anschließend in die Kopfhaut injiziert. Dieses Plasma ist reich an Wachstumsfaktoren und Mikronährstoffen, die die Haarfollikel stimulieren und das Nachwachsen der Haare fördern können.Eine der führenden Kliniken auf diesem Gebiet ist LeicesterHaar in Deutschland. Mit modernster Technik, fundiertem medizinischem Know-how und individuell abgestimmten Therapiekonzepten bietet LeicesterHaar besonders bei Autoimmun-Haarausfall wie Alopecia areata wirkungsvolle und sichere Behandlungen. Das erfahrene Expertenteam ist auf biologische und regenerative Verfahren spezialisiert und begleitet Patient:innen ganzheitlich auf dem Weg zu mehr Haarwachstum und Lebensqualität.
Was sind andere Ursachen für kahle Stellen im Bart, auf der Kopfhaut oder den Augenbrauen?

Kahle Stellen: Nicht immer ist es Alopecia areata
Kahle Stellen im Bart, auf der Kopfhaut oder an den Augenbrauen müssen nicht zwangsläufig auf eine Alopecia areata hinweisen. Es gibt zahlreiche weitere Ursachen, die zu lokalem oder flächigem Haarausfall führen können – manche reversibel, andere dauerhaft.
Infektionen der Kopfhaut
Pilzinfektionen (Tinea capitis) oder bakterielle Entzündungen der Kopfhaut sind eine häufige Ursache für lokal begrenzte kahle Stellen – insbesondere bei Kindern. Laut einer klinischen Studie aus den USA betrifft Tinea capitis bis zu 4–6 % der Vorschulkinder in städtischen Regionen. Typische Begleiterscheinungen sind Juckreiz, Schuppenbildung und Rötungen, was sie deutlich von Alopecia areata unterscheidet.
Vernarbende Alopezie
Formen der vernarbenden Alopezie wie die Frontal fibrosierende Alopezie (FFA) oder der Lichen planopilaris führen zu einer dauerhaften Zerstörung der Haarfollikel. Eine Publikation im Journal of the American Academy of Dermatology berichtet, dass FFA besonders postmenopausale Frauen betrifft – mit steigender Tendenz weltweit. Diese Erkrankungen sind oft entzündlich und erfordern frühzeitige medizinische Intervention, um den Haarverlust zu begrenzen.
Narbenbildung durch Verletzungen
Mechanische Traumen, wie Schnitte, Verbrennungen oder chirurgische Eingriffe, können durch Narbenbildung zu permanenten kahlen Stellen führen. Diese Form des Haarausfalls ist in der Regel nicht reversibel, da das Narbengewebe keine Haarfollikel mehr enthält.
Psychische Ursachen: Trichotillomanie
Eine oft unterschätzte Ursache ist die Trichotillomanie, eine psychische Zwangsstörung, bei der sich Betroffene wiederholt selbst Haare ausreißen. Diese Erkrankung beginnt häufig im Jugendalter und betrifft laut DSM-5-Daten etwa 1–2 % der Bevölkerung. Die entstehenden kahlen Stellen können denen bei Alopecia areata ähneln, zeigen aber oft ein unregelmäßiges Muster.
Erblich bedingter Haarausfall
Die androgenetische Alopezie – also der erblich bedingte Haarausfall – ist die häufigste Form von Haarverlust weltweit. Sie betrifft ca. 80 % der Männer und bis zu 50 % der Frauen im Laufe ihres Lebens, wie eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 zeigt. Der Haarverlust verläuft hier in einem typischen Muster (z. B. Geheimratsecken, Tonsur) und unterscheidet sich somit meist deutlich von kreisrundem Haarausfall.
Diffuser Haarausfall mit lokalen Schwerpunkten
Auch ein diffuser Haarausfall – also eine gleichmäßige Ausdünnung über den gesamten Kopf – kann sich manchmal in bestimmten Bereichen stärker zeigen und fälschlicherweise wie eine Alopecia areata wirken. Ursachen hierfür reichen von hormonellen Schwankungen über Nährstoffmängel bis hin zu Schilddrüsenerkrankungen.
Fazit: Die richtige Diagnose ist entscheidend
Gerade bei unspezifischen Symptomen wie einer einzelnen kahlen Stelle ist eine sorgfältige Differenzialdiagnose entscheidend. Nur durch eine gründliche Anamnese, ggf. Blutanalysen, Trichoskopie und histologische Untersuchungen lässt sich die genaue Ursache feststellen und eine passende Therapie einleiten. In vielen Fällen ist eine frühzeitige Abklärung durch spezialisierte Dermatolog:innen der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung.
Welche Arten von Haartransplantationen gibt es gegen Kahlheit?

Ob eine Haartransplantation bei kahlen Stellen eine geeignete Lösung darstellt, hängt in erster Linie von der Ursache des Haarausfalls sowie vom Fortschreiten der Erkrankung ab. Bei kreisrundem Haarausfall (Alopecia Areata) ist in den meisten Fällen keine Transplantation notwendig, da sich die Haare entweder spontan oder durch gezielte Therapien wieder regenerieren können. Wichtig ist jedoch: Eine Haartransplantation stellt keine Heilung der Grunderkrankung dar – bei einem erneuten Schub kann es an anderer Stelle erneut zu Haarausfall kommen.
Sollte jedoch nach Ausschöpfung aller konservativen und medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten weiterhin keine ausreichende Haarneubildung zu beobachten sein, kann eine Transplantation in Erwägung gezogen werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Haarausfall vollständig zum Stillstand gekommen ist. Nur so kann verhindert werden, dass neu verpflanzte Haarfollikel durch fortschreitenden Verlust im Umfeld wieder gefährdet werden.
Für viele Patient:innen bietet insbesondere die FUE-Haartransplantation eine moderne und schonende Möglichkeit, lichte Stellen aufzufüllen. Bei dieser Methode werden einzelne Haarfollikel mit einem feinen Mikropunch aus dem Spenderbereich entnommen und präzise in die kahlen Areale eingesetzt. Alternativ dazu bietet die DHI-Methode (Direct Hair Implantation) eine noch gezieltere Einsetzung durch spezielle Implantationsstifte – ideal für besonders dichte und natürliche Ergebnisse.
Auch für besondere Haartypen wie Afro-Haar hat sich die Afro-Haartransplantation bewährt. Diese Methode berücksichtigt die einzigartige Struktur und Krümmung afrotexturierter Haare und erfordert besonders viel Erfahrung. Darüber hinaus bietet LeicesterHaar auch spezialisierte Lösungen für Frauen mit Haarausfall, bei denen oft hormonelle oder genetische Faktoren eine Rolle spielen.
LeicesterHaar gilt als eine der führenden Adressen in Deutschland für hochwertige und individuelle Haartransplantationen. Mit modernster Technik, erfahrenem Fachpersonal und maßgeschneiderten Behandlungskonzepten wird jede Transplantation auf die Bedürfnisse der Patient:innen abgestimmt – sei es bei genetischem Haarausfall, Narben, Unfällen oder dauerhafter Lichtung bestimmter Bereiche.